Es
zeugt von meiner absoluten Blauäugigkeit (sprich Ahnungslosigkeit), dass sich
in meinem Tortour-Gepäck unter anderem ein Buch für den Zeitvertrieb befand.
Zeitvertrieb? Lesen? Welche Zeit? Und mit welchen Augen? Wir waren von Anfang
an (und der lief ziemlich schlecht) gefordert, und bis zum bitteren Ende hatten
wir keine einzige Minute, in der wir nicht wussten, was wir tun sollten,
geschweige denn noch fähig gewesen wären zu lesen.
Aber zurück zum Start: Donnerstagnacht
um eins deponierten wir unsere vier Athleten am Start und fuhren mit den zwei
Begleitfahrzeugen (zwei vollgepackte Kleinbusse) nach Frauenfeld an die erste Wechselstation.
Dieser erste Abschnitt wurde ausnahmsweise von allen vier Athleten gemeinsam
zurückgelegt, danach sollte jeweils nur noch einer pro Strecke im Einsatz sein,
während die anderen an die jeweiligen Übergabeorte überführt wurden.
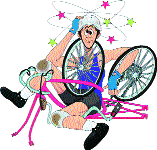 Kaum trafen wir in Frauenfeld
ein, kam ein Anruf vom Athletenteam: Einer unserer Radfahrer fuhr ungebremst in
unseren Rollstuhlsportler, und nebst einigen Verletzungen des Rennradfahrers
war ein Rad des Rennstuhls defekt. Der zweite Bus konnte in Frauenfeld bleiben,
während wir mit dem Ersatzrad sofort wieder zurück zum Start fuhren. Dort sass
einer unserer Radrennfahrer gebeugten Hauptes am Strassenrand, umsorgt von
Sanitätern (kaputte Schulter, kaputter Schleimbeutel am Knie, Prellungen
überall), ein Fernsehteam wuselte herum, um dieses gefundene Fressen zu filmen,
unser Rollstuhlfahrer wartete mit zwei statt drei Rädern, und die anderen zwei
Team-Fahrer machten sich Sorgen um den Zeitverlust.
Kaum trafen wir in Frauenfeld
ein, kam ein Anruf vom Athletenteam: Einer unserer Radfahrer fuhr ungebremst in
unseren Rollstuhlsportler, und nebst einigen Verletzungen des Rennradfahrers
war ein Rad des Rennstuhls defekt. Der zweite Bus konnte in Frauenfeld bleiben,
während wir mit dem Ersatzrad sofort wieder zurück zum Start fuhren. Dort sass
einer unserer Radrennfahrer gebeugten Hauptes am Strassenrand, umsorgt von
Sanitätern (kaputte Schulter, kaputter Schleimbeutel am Knie, Prellungen
überall), ein Fernsehteam wuselte herum, um dieses gefundene Fressen zu filmen,
unser Rollstuhlfahrer wartete mit zwei statt drei Rädern, und die anderen zwei
Team-Fahrer machten sich Sorgen um den Zeitverlust.
Ab Frauenfeld ging es für den Rollstuhlfahrer
gleich weiter nach Unterwasser. Klingt harmlos, ist aber in Wirklichkeit eine
ziemliche Tortour, nicht nur für den Fahrer. Die Strecke wurde mitten in der
Nacht und erst noch bei Leermond gefahren, vollste Konzentration war angesagt. Um
dem Fahrer den Weg möglichst gut auszuleuchten, fuhren wir immer knapp hinter
dem Rollstuhl. Und auch wenn besagter Rollstuhl-Athlet mehrfacher Paralympics-
und WM-Sieger und somit gleich schnell wie die Radrennfahrer ist: Mit 25
Stundekilometern braucht es einfach seine Zeit bis ins Toggenburg. Aber noch
waren wir ja einigermassen frisch, die Moral gut und irgendwann dämmerte es am
Himmel, was unsere müden Augen mit Freude zur Kenntnis nahmen (ein erster
Anflug von Zweifel kam trotzdem auf: Schaffen wir das? Noch zwei weitere Tage
und eineinhalb Nächte?).
Weiter ging‘s… in Chur übernahm
die zweite Hälfte unseres Teams, so dass wir Rollstuhl, Rennvelo und Fahrer ins
Auto packen konnten, um möglichst rasch an den nächsten Übergabeort zu
gelangen. Sprich auf schnellsten Weg von Chur auf den Grimselpass (was
natürlich nicht wirklich schnell geht, sondern seine Zeit braucht). Unterdessen
traf auch das vorausgesagte Gruselwetter ein, was den ungeduschten Sportler
(und Chauffeur)-Mief noch verstärkt, die Anzahl nasser Veloschuhe und
triefender Sportbekleidung erhöht und die Scheiben beschlägt. Auf dem Grimsel
hatten wir etwas Zeit uns auszuruhen, bis die andere Teamhälfte per Velo
eintraf. Diese Zeit sollte man zum Schlafen nutzen, was sich aber schwierig
gestaltet mit vier Personen plus Gepäck im Bus. Immerhin, liegen und die Augen
entspannen tat schon mal gut (auch wenn es ungemütlich war verteilt über die
zwei Fahrersitze, mit dem Steuerrad im Gesicht und der Angst, jederzeit mit dem
Ellenbogen ungewollt die Hupe zu betätigen).
Tatsächlich traf unser verletzter
Fahrer dann auf dem Grimsel ein, was wir nicht wirklich erwartet hätten nach
seinem Sturz gleich zu Beginn. Und wie er dort oben eintraf… Wir wurden alle
bleich bei seinem Anblick: Graublau im Gesicht konnte er vor Kälte und
Schmerzen nicht mehr selbstständig vom Rennrad absteigen, und mich schaudert
noch immer, wenn ich daran denke, wie er sich danach zum Bus quälte, mit
hängender Schulter und kaputtem Knie. Aber er ist hart im Nehmen, und auf die
(natürlich etwas doofe) Frage, wie es ihm denn gehe, antwortete er: „Vor 24
Stunden um diese Zeit ging es mir etwas besser, aber ist schon ok.“ Ich frage
mich noch jetzt, welche Droge sie ihm einflössten.
Nach stundenlangem Fahren im
Velotempo, tagsüber und mitten in der Nacht, ohne richtige Verpflegung oder
Schlaf, wurde es richtig hart. Dass die Tortour nicht nur für die Athleten eine
Tortur sein sollte, sondern auch für uns als Betreuer und Chauffeur, war mir
nicht wirklich bewusst. Natürlich wusste ich, dass ich an meine Grenzen kommen
würde, aber wie die Realität dann wirklich ist, sollte ich erst noch zu spüren
bekommen. Mitten in der Nacht in Lausanne, bei Starkregen, nach 36 Stunden ohne
Schlaf, im Follow-Car-Modus, spürte ich, dass es schlicht nicht mehr geht.
Tränende Augen, Hunger, Müdigkeit, Konzentrationsprobleme und die Angst, bei
einem Sturz einer der mittlerweile auch sehr mitgenommenen Athleten nicht
rechtzeitig zu reagieren führten dazu, dass mein Mann übernehmen musste. Zwar genauso
müde wie ich, aber immerhin ohne tränende Augen. Kurz darauf wurde es für
unseren Rollstuhl-Sportler (zum guten Glück für uns) zu gefährlich, wir packten
ihn für die verbleibende Teilstrecke mitsamt Renngefährt in den Bus, was eine
willkommene Fahrpause mit sich führte, und etwas Bewegung und Erholung für die
übermüdeten Augen bedeutete.
Zu jener Zeit wusste ich schon
nicht mehr, wie ich den Rest des Rennens überstehen sollte, und auf unsere
Athleten war ich gar etwas neidisch. Denn trotz der riesigen körperlichen
Anstrengung konnten diese sich nach zurückgelegter Strecke hinlegen, die Augen
schliessen und sich etwas erholen, während wir sie zum nächsten Wechselpunkt
fuhren, und dort wieder einen der beiden im Velotempo weiter begleiteten. Dazu
kam, dass die Strecke nicht ausgeschildert war. Derjenige, der nicht hinter dem
Steuer sass, lotste also mittels Navigationsgerät und achtete auf allfällige
Geschehnisse, die der Fahrer in seinem Zustand nicht mehr mitbekam.
Nun ja, irgendwann in der Mitte
des Jura, am Samstagmittag, wurde entschieden, dass wir das Rennen abbrechen,
da es nicht mehr realistisch war, in den 48 Stunden ans Ziel zu kommen. Das
garstige Wetter führte auch nicht gerade zu grossen Motivationsschüben, und
Regenwürmer in der Nase machen schlicht keinen Spass. So fuhren wir also
direkten Weges vom Jura nach Schaffhausen. Auf der Autobahn, mitten im Verkehrswahnsinn
eines ganz normalen Samstagnachmittags, mit dem kleinen Konzentrations-Bonus eines
60-stündigen Schlafentzugs.
Fazit: Sinnvoll? Nein.
Gefährlich? Definitiv. Grenzerfahrung? Ja. Zu wiederholen? Nein! (In diesem
letzten Punkt waren sich alle einig…). Und sollte dieser Text anders als sonst
daherkommen: Mein Hirn fühlt sich auch nach 14 Stunden komatösem Schlaf noch an
wie Matsch. Ich ertappte mich heute (Mittag) nach dem Frühstück dabei, wie ich den
Orangensaft wieder auf den Tisch zurück- und die Kaffeetasse in den Kühlschrank
stellte. Und statt Haarspray war da plötzlich Gesichtscrème… aber das bessert
nach einer zweiten durchschlafenen Nacht bestimmt wieder.




Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen